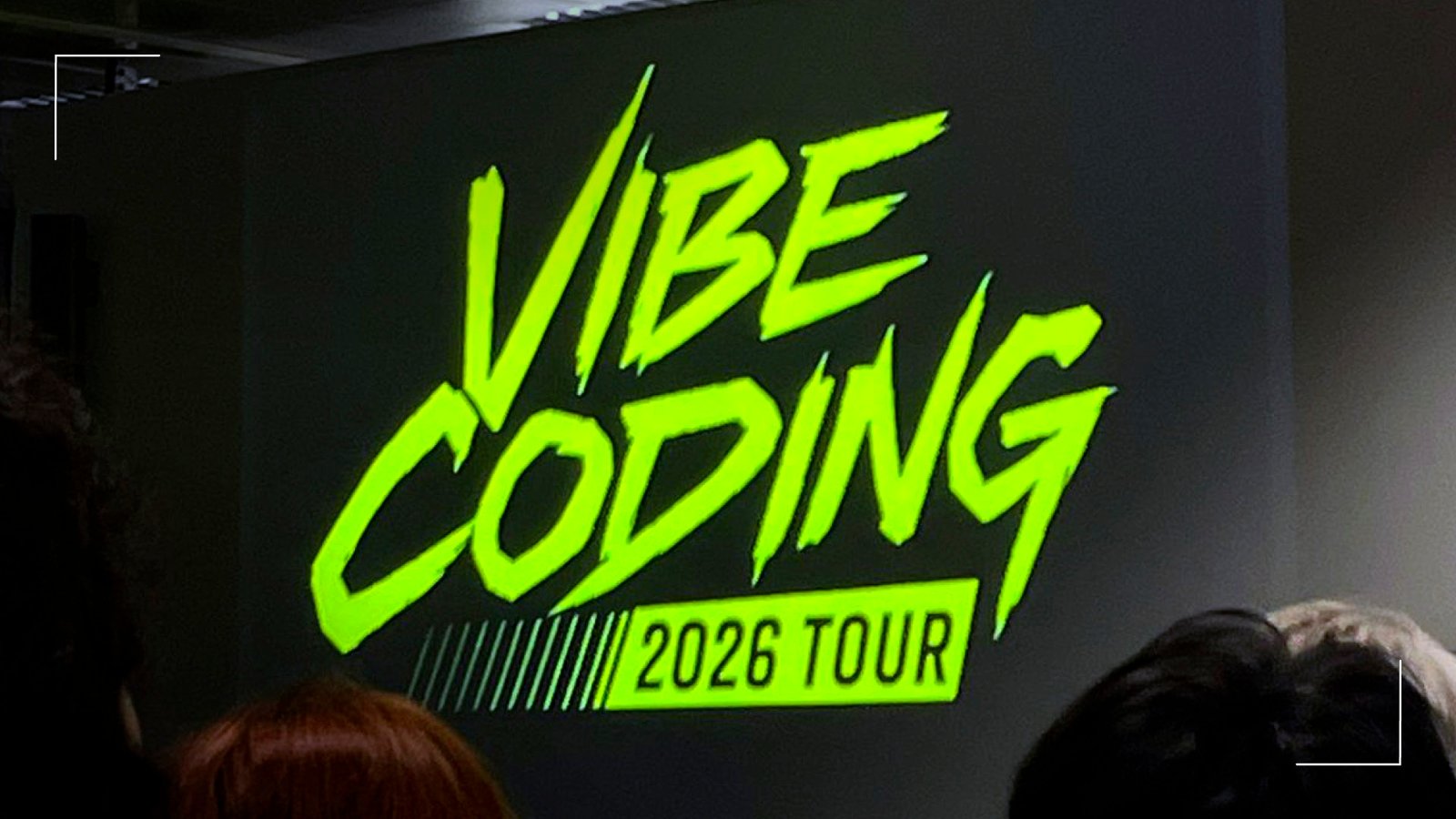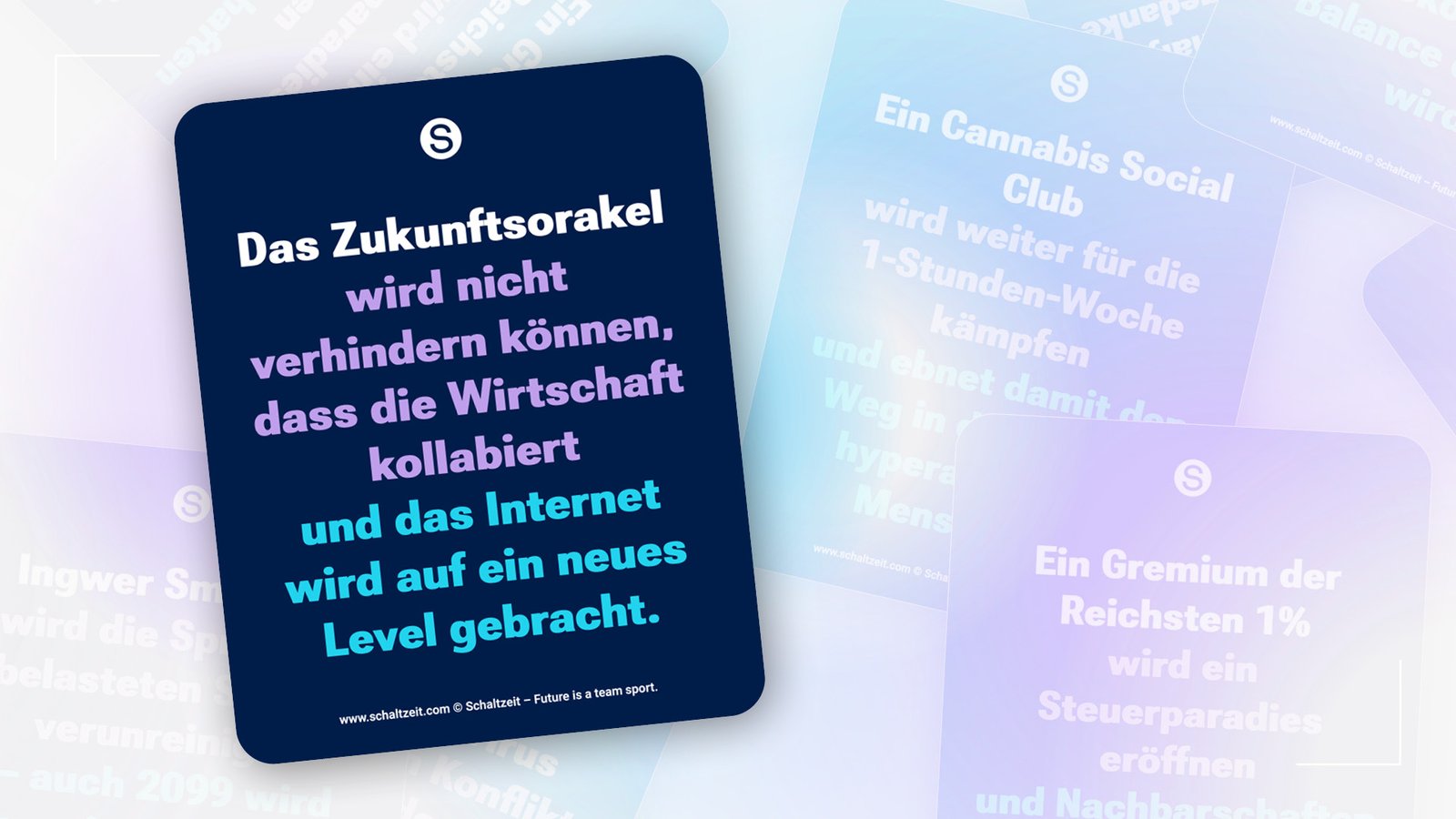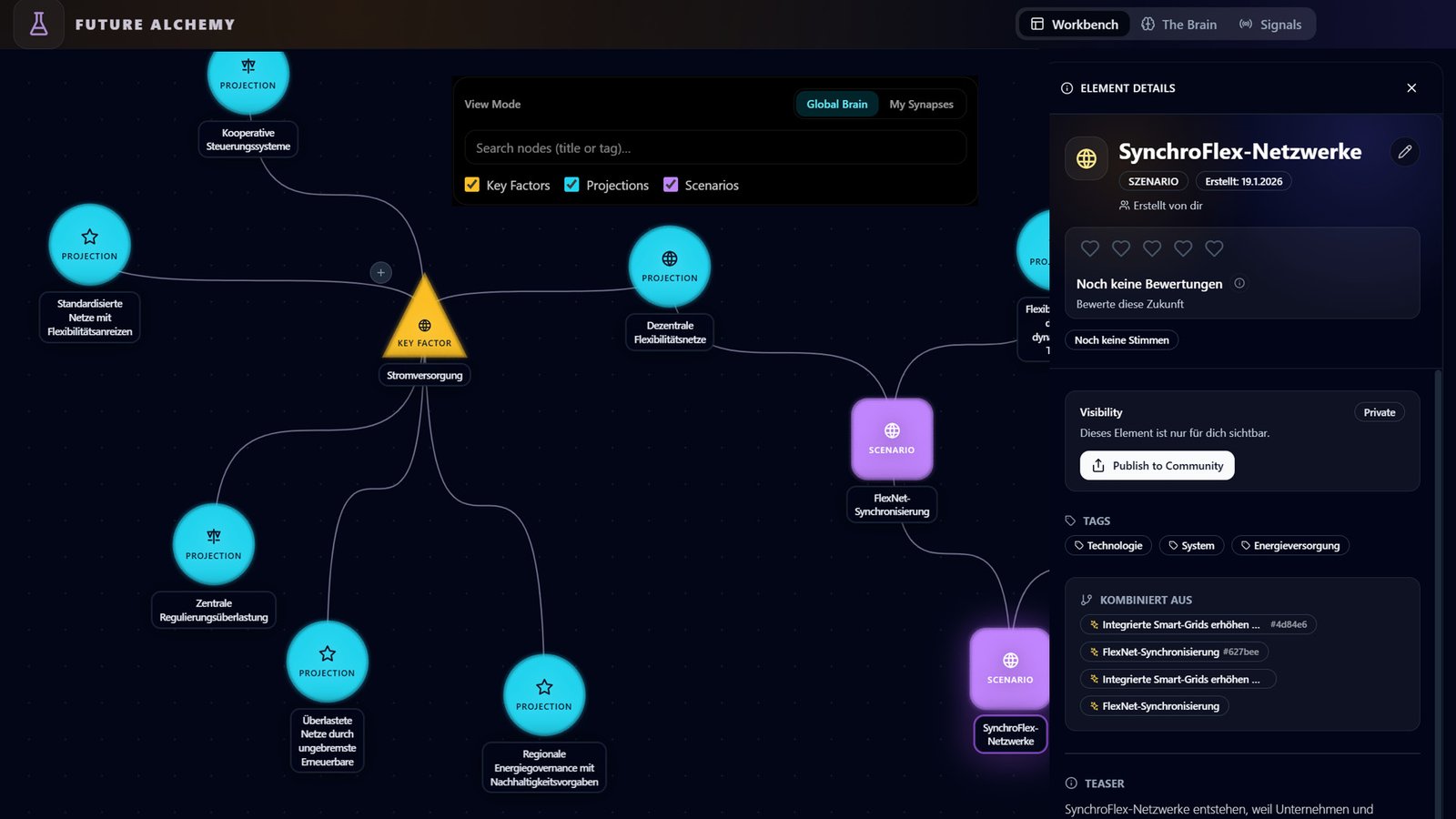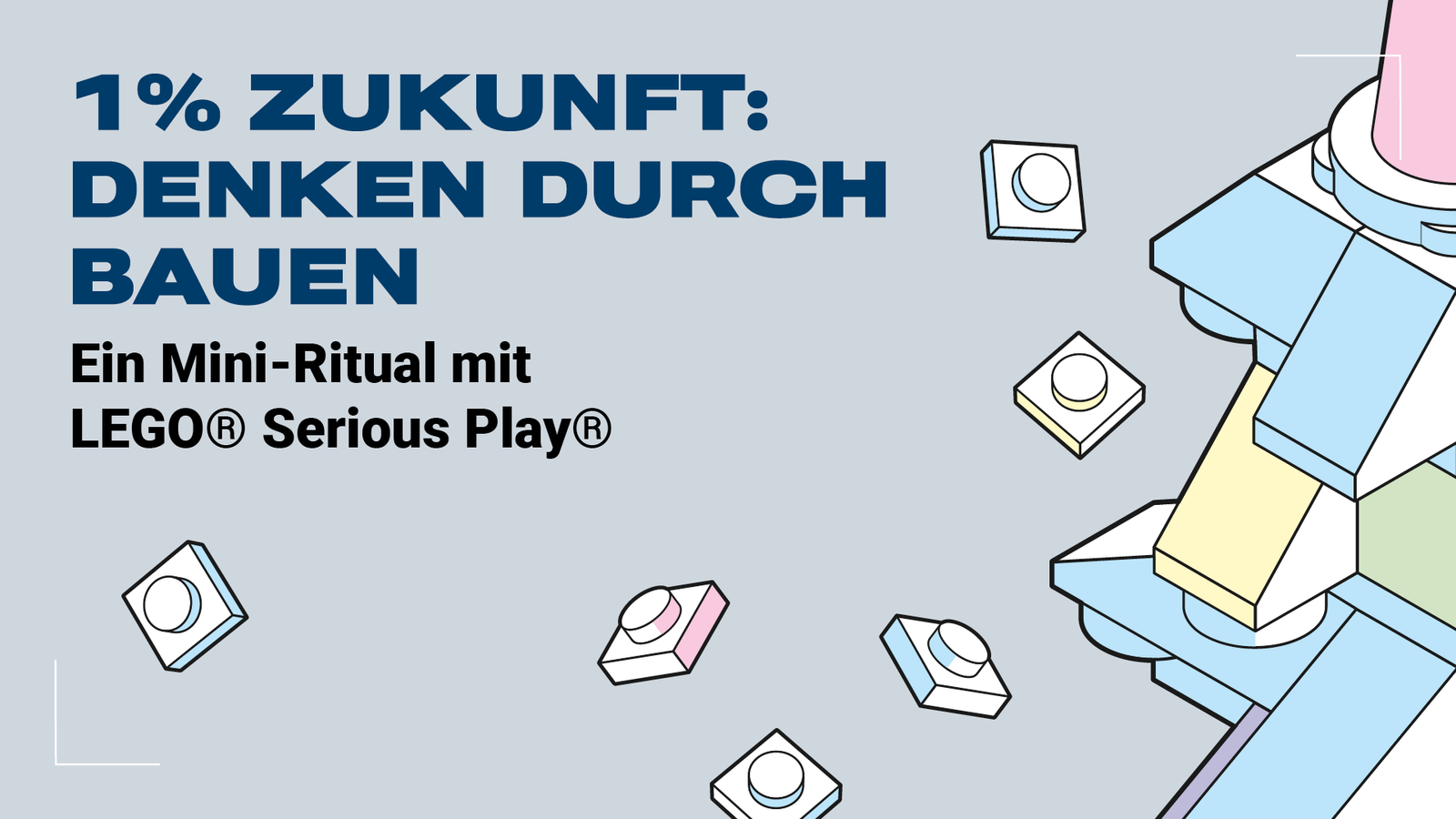Methode: Was ist Ziel der CLA?
- Kritische Zukunftsforschung


- Ebene der Litany: Verbreitete (mediale) Debatten um Zukunftsthemen
Die oberste sichtbare Ebene der CLA wird Litanei genannt. Umgangssprachlich wird der Begriff Litanei auch in abwertender Form für eine endlose Aufzählung oder ein eintöniges Gerede verwendet – es sind also wenig differenzierte weitverbreitete Zukunftsaussagen gemeint (die nicht selten einen angstschürenden dystopischen Charakter aufweisen). - Ebene des Systems: Strukturelle Analysen der Zukunftsthemen
Die zweite Ebene, die direkt unter der Wasseroberfläche liegt, behandelt die systemisch-strukturelle Ebene und beleuchtet die sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Ursachen. Bei differenziertem Interesse an einem Zukunftsthema ist diese Ebene gut zugänglich – durch Fachliteratur und wissenschaftliche Erkenntnisse. - Ebene des Weltbilds: zugrundeliegenden Weltanschauungen der Diskurse
Für die dritte Ebene muss deutlich tiefer getaucht werden; hier geht es um die tief verankerte Denkmuster und Paradigmen, die unser Verständnis der Welt prägen: „At this stage, one can explore how different discourses (the economic, the religious, the cultural, for example) do more than cause or mediate the issue but constitute it, how the discourse we use to understand is complicit in our framing of the issue“( Inayatullah, 1998, S. 820). - Ebene der Mythe und Metaphern: Kulturell verankerte Geschichten und Bilder
Die Weltbilder spiegeln sich in Mythen und Metaphern, mit denen kollektive Archetypen, unbewusste Geschichten und emotionale Bilder vermittelt werden, die unser (Bauch-)Gefühl in Bezug auf das jeweilige Thema formen.



Anwendung: Marsmission, De-Extinction & Appropriate Technology – Welche Bilder und Mythen haben wir dekonstruiert, was waren kritische Gedanken?
Als einleitendes Beispiel für den CLA-Abend schauten wir uns die Rolle von Musks Tech-Visionen an und die Idee, dass sich die zukünftige Menschheit auf den Mars ausbreitet.
- Die Litanei wären hier beispielsweise Schlagzeilen über Raketenstarts von SpaceX, Pläne für zukünftige Mars Missionen oder Aussagen von Musk selbst zur „multiplanetaren“ Menschheit, aber auch die Angst vor der Zerstörung unseres aktuellen Planeten und die damit verbundene Bedrohung unserer Lebensgrundlage.
- Auf struktureller Ebene kann die Konzentration auf einzelne Tech-Giganten als zentrale Player der Tech Branche und entstehende Tech-Oligopole eingegangen werden sowie auf staatliche Fördermittel oder den Einfluss in Politik und Wirtschaft.
- Als Weltbild hingegen wurde diskutiert, inwieweit der Tech-Utopismus dazu führt sich an dem Glauben festzuhalten, dass technologische Fortschritt die Lösung der brennenden globalen Probleme darstellen wird – mit Technologien, die maßgeblich von einzelnen zentralen Akteuren vorangebracht werden anstatt durch kollektive Gestaltung.
- Dem liegt die Vorstellung des archetypischen Erfinder-Genies zugrunde, einem heldenhaften Tech-Vorreiter, der durch seine Risikobereitschaft, Mut und starke Mission die Menschen mit seinen genialen Innovationen rettet – Jemand wie der charismatische und geniale Marvel Held Iron Man. Musk wird teilweise mit Tony Stark verglichen, nicht nur wegen seines technologischen Unternehmertums, sondern auch wegen seines öffentlichen Images als exzentrischer Visionär.



- Das Kernziel von Colossal ist nicht die reine Wiederbelebung, sondern die Wiederherstellung und Stärkung von Ökosystemen. Litanei wären also u.a. die die Bedrohung der Ökosysteme und Angst um resultierende Folgen für den Menschen. Durch De-Extinction sollen die Ökosysteme mithilfe von Gentechnik gerettet werden.
- Auf systemischer Ebene wurden wissenschaftliche Erkenntnisse über Ökosysteme und Schlüsselarten adressierte, sowie die zerstörerischen Auswirkungen des Klimawandels auf diese.
- Es wurde das Weltbild herausgelesen, dass Wissenschaft in der Lage ist Ökosysteme nicht nur zu verstehen, sondern auch zu reparieren. Auch Elemente des Transhumanismus wurden identifiziert und über eventuelle Hidden Agenda spekuliert.
- Als zugrundeliegende Geschichte wurden u.a. aus christlicher Perspektive das Bild des Menschen, der in die Schöpfung eingreift und Gott spielt, gesehen aber auch die Matrix Metapher.
Spannend war die Überlegung der Rekonstruktion, ob und wie weit sich Tech-Visionen verändern, wenn die zugrunde liegende Geschichte alternativ auf der Gaia-Hypothese aufbaut und die Erde (Gaia) damit als ein selbstregulierendes System verstanden wird. Verändert man die Metapher zu „Mutter Erde“, die „Fieber hat“, wird fragwürdig, ob eine artifizielle Wiederbelebung einzelner Tierarten das System heilen kann. Die Rolle der Wissenschaft verschob sich dabei weg vom Eingreifen in das selbstregulierende System hin zu einem besseren Verstehen, Schützen und Respektieren unseres natürlichen Systems.
- Als Beispiel wurde dabei u.a. das Open-Source-Betriebssystem Linux herangezogen. Dessen Litanei ist die Forderung, dass alle Nutzer*innen die Freiheit haben sollten, das System zu verwenden, den Quellcode einzusehen, anzupassen und weiterzugeben.
- Auf der systemischen Ebene wurden Konkurrenzkämpfe und Marktlogiken großer Tech-Akteure benannt sowie das Prinzip der OpenSourceLizenz.
- Das Weltbild scheint damit stark auf Souveränität von Anwender*innen und sowie einem kollektiven Besitztum des Wissens/Codes aufzubauen – verbunden mit einer kritischen Perspektive auf die Macht großer kapitalistischer Softwareanbieter.
- Dies wurde mit den Geschichten von beherrschenden Machtinstanzen und rebellischen Gegenbewegungen assoziiert (Empire vs. Underground Kämpfer*innen). Als Vorschlag für ein metaphorisches Bild von Open Source Code als dezentrales sich selbst weiterentwickelndes Wissenskonstrukt kam das Geflecht eines Pilz Mycels hervor: Eine Struktur, die sich weit verzweigt, verselbständigt und an verschiedensten Stellen Nährstoffe bzw. neues Wissen aufnehmen. Als popkulturelles Pendant dazu kam die Pflanzenwelt von Avatar auf, wo Pflanzen durch feine Fasergeflechte miteinander verbunden sind und wie ein großes dezentrales neuronales Netz fungieren, das Wissen in sich trägt an dem alle teilhaben können.
In der Rekonstruktion fiel es uns schwer neue Bilder zu finden, spannenderweise fiel uns kaum eine Geschichte ohne Machtkampf als zentrales Element ein. Dennoch entstand eine spannende Debatte über Modularität und die Möglichkeiten parallel existierender Systeme.
Spannende Überlegung: Der Ozean um den Eisberg als 5. Ebene?

Die Frage, ob die CLA durch eine weitere Ebene, den Ozean, erweitert werden könnte, machte eine spanenden Diskussion auf: Gibt es gleichbleibende Elemente, die sich durch alles ziehen? Wie die Strömungen des Ozeans, die den gesamten Eisberg tragen und verändern? Gäbe es – wie auch auf unserem Globus – verschiedene in Verbindungstehende Ozeane mit eigenen Dynamiken, je nach Kulturkreis beispielsweise?
Auch spannend war die Frage, ob nicht auf die Metapher des Eisbergs selbst eine gewisse Denklogik vorgibt, die dazu führt, dass andere Fragen übersehen werden.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden des CLA-Abends für den sehr spannenden Austausch und die vielen kritischen Denkanstöße! Abschließend zeigt uns der CLA-Abend eindrucksvoll, wie wertvoll es ist, verborgene Annahmen unseren Zukunftsbildern zu erkennen und dadurch völlig neue Perspektiven zu gewinnen oder blinde Flecken in Form nicht mitgedachter Perspektiven aufzudecken.
Hier setzen wir bei Schaltzeit an: Mit einem breiten Repertoire an verschiedenen Ansätzen und Methoden unterstützen wir Dich im Umgang mit den Ungewissheiten der Zukunft und der Erarbeitung innovativer Wege. Gemeinsam mit Dir finden wir heraus, welche Herangehensweisen und Werkzeuge am besten zu Deinen Zielen passen – sprich uns einfach an.
Das ergänzende Arbeitsblatt zur CLA steht hier kostenfrei für Dich zum Download bereit.
Und wenn Du interaktiv in weitere Methoden eintauchen möchtest, freuen wir uns, Dich bei einer unserer nächsten Veranstaltungen begrüßen zu dürfen: Zu den Veranstaltungen
Medialer Bericht zur Mars Mission:
- Inayatullah, S. (1990). Deconstructing and reconstructing the future: Predictive, cultural and critical epistemologies. Futures, 22(2), 115-141.